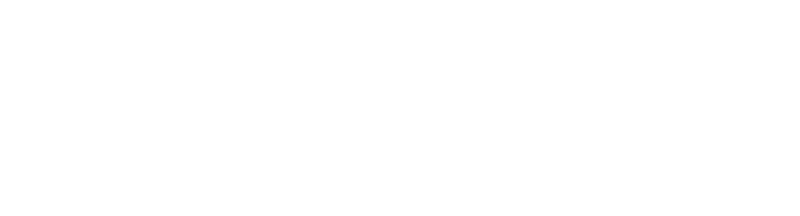Winterpilze
Selbst im Winter lassen sich einige wenige (teils essbare) Pilzarten finden. „Echte“ Winterpilze verfügen über spezielle Proteine, die wie ein integriertes Frostschutzmittel wirken. Diese verhindern, dass das Wasser in den Zellen bei Minustemperaturen gefriert und die Zellen dadurch platzen. Die folgenden drei Arten sind frostresistent und können daher auch im Winter als Speisepilze gesammelt werden.
Judasohr(Auricularia auricula-judae)
Judasohren sind leicht kenntlich und daher auch absoluten Anfängern zu empfehlen. Es gibt keine nennenswerten gefährlichen Doppelgänger. Lediglich der Kreisel-Drüsling (gilt als essbar) soll schon für ein Judasohr gehalten worden sein. Wer gezielt nach Judasohren suchen möchte, sollte vor allem alte Holundersträucher absuchen. Der Pilz wächst übrigens ganzjährig, seine Hauptsaison liegt jedoch zwischen Spätherbst und Frühjahr. Im Einzelhandel wird eine sehr ähnliche Art auch getrocknet als „MuErr-Pilz“ oder „Chinesische Morchel“ verkauft. Mit echten Morcheln (Morchella spp.) hat dieser Pilz allerdings weder mykologisch noch kulinarisch etwas gemeinsam.

Judasohren an Holunder. Fund bei Würzburg am Mainufer, Januar 2021.

Judasohren an einem Bachlauf, Nähe Schwarzach im Landkreis Kitzingen, Dezember 2021.

tiefgefrorene Judasohren in einem Auwald am Main bei Würzburg, Januar 2023 .

Samtfußrüblinge an Rotbuche, Friedrichsberg bei Abtswind, Dezember 2021.
Samtfußrübling(Flammulina velutipes)
Samtfußrüblinge wachsen bevorzugt in dichten Büscheln und treten in der Regel nach den ersten Nachtfrösten fast ausschließlich auf totem Laubholz auf, was auf ihre saprotrophe Lebensweise hinweist. Die honiggelben bis orangefarbenen Hüte sind dünnfleischig und leicht schmierig, besonders bei feuchter Witterung. Der namensgebende „Samtfuß“ bezieht sich auf den charakteristisch samtigen, oft dunkleren Stiel, der ein zentrales Bestimmungsmerkmal darstellt. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Fruchtkörper stets vollständig mitsamt Stiel zu entnehmen. Obwohl die Stiele aufgrund ihrer zähen Konsistenz ungenießbar sind, liefern sie wertvolle Hinweise zur exakten Bestimmung. Das Sporenpulver hinterlässt einen weißen bis blass cremefarbenen Abdruck, was im Zweifelsfall das eindeutigste Bestimmungsmerkmal ist.

unzählige Fruchtkörper an Laubholz, Friedrichsberg bei Abtswind, Dezember 2023.

Samtfußrüblinge an Pappel, Nähe Ochsenfurt am Mainufer, Dezember 2022.
Achtung gefährliche Verwechslungen möglich!
Es gibt eine ganze Reihe anderer ähnlich aussehender Pilzarten, die an (alten) Holzsubstraten gefunden werden können.
Die gefährlichste Verwechslung besteht mit dem Gifthäubling (Galerina marginata). Der Name ist Programm, denn diese Pilzart ist tödlich giftig! Gifthäublinge enthalten die gleichen organschädigenden Amatoxine wie der Grüne Knollenblätterpilz. Dieser Pilz muss immer sicher ausgeschlossen werden. Andernfalls sollten keine Samtfußrüblinge und schon gar keine Stockschwämmchen gesammelt werden. Üblicherweise erscheinen Gifthäublinge vor allem im Spätherbst. Da die Winter aber immer milder ausfallen, sollte auch zur kalten Jahreszeit immer mit der Art gerechnet werden.

Vergleichsbild vom 19.12.2021, von links nach rechts:
- Samtfußrüblinge (Flammulina velutipes s.l.), essbar
- Stockschwämmchen (Kuehneromyces mutabilis), essbar – nur Pilzkennern zu empfehlen!
- Ältere Gifthäublinge (Galerina marginata), tödlich giftig!
- Trompetenschnitzlinge (Tubaria furfuracea cf.), ungenießbar
- Grünblättrige Schwefelköpfe (H. fasciculare), stark (margendarm-) giftig
- Ziegelroter Schwefelkopf (Hypholoma lateritium), giftig bis ungenießbar

Gifthäublinge findet man vor allem auf Holzsubstraten in Nadelwäldern. Die Art wurde lange Zeit auch „Nadelholzhäubling“ genannt, bis man feststellte, dass sie ebenso an Laubholz vorkommt.
Fund aus einem Kiefernwald, Bild aus November 2023.

Der silbrig-fasrige Stiel, ein vergänglicher Ring und ein muffiger, mehlartiger Geruch sind typische Merkmale des Gifthäublings. Der Hutrand älterer Exemplare ist oft gerieft, und die Hüte können hygrophan sein. Die Lamellen dunkeln mit dem Alter nach, das Sporenpulver ist bräunlich. Gefunden an moosbewachsenem Rotbuchenholz, Bild aus Dezember 2023.

Selbst unter der Schneedecke lassen sich oft viele Herbstpilze noch finden
Vergleichsbild von Ende November 2023:
Links sind drei Samtfußrüblinge, und rechts sind drei Gifthäublinge. Alle Fruchtkörper wurden zusammen am gleichen Rotbuchenstamm (Fagus sylvatica) gefunden. Es ist daher absolut fahrlässig zu glauben, dass a) Gifthäublinge nur auf Nadelholz wachsen und b) sie im Winter nicht zu finden wären. Ein sicheres Erkennen des Gifthäublings ist unerlässlich, wenn man Samtfußrüblinge sammeln möchte.
Austernseitling(Pleurotus ostreatus)
Der Austernseitling wächst, wie der Samtfußrübling, oft in dichten Büscheln auf Totholz, vor allem auf dicken, alten Rotbuchen-stämmen. Die weißen Lamellen laufen deutlich am Stiel herab, während der Hut silbergrau bis hellbraun ist.
Fun Fact: Dieser Pilz ist omnivor und ernährt sich neben Holz auch von Fadenwürmern. Er lähmt seine Beute mit einem Nervengift, bevor die Fadenwürmer von den Pilzhyphen durchwachsen und verdaut werden.
Eine theoretisch gefährliche Verwechslung gibt es mit dem Ohrförmigen Seitling (Pleurocybella porrigens), der jedoch nur auf alten Nadelhölzern wächst und im Flachland selten vorkommt. In Unterfranken ist die Art wohl bislang noch nicht gefunden worden. Tödliche Vergiftungen wurden bislang nur in Japan berichtet. Dazu hat der DGfM-Toxikologe Prof. Dr. Siegmar Berndt einen Fachartikel veröffentlicht, der unter „Der Todesengel Pleurocybella porrigens“ im Internet zu finden ist.

Austernseitlinge an Rotbuche, Nähe Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch, Dezember 2021.

gefrorener Austernseitling. In seltenen Fällen ist die Art, wie hier, auch auf Nadelholz zu finden. Bild aus Dezember 2021.

Austernseitlinge am Rotbuchenstumpf bei Castell, Dezember 2022.

Der Austernseitling ist der ergiebigste Winterpilz. Besonders alte Rotbuchen können wie hier unzählige Fruchtköper hervorbringen.
Gefunden im Landkreis Kitzingen, Januar 2023.

typsicher Verwechslungspartner: Links zwei Gelbstielige Muschelseitlinge (Sarcomyxa serotina), diese sind ungenießbar. Rechts sind Austernseitlinge zu sehen. Die Lamellen sind deutlich herablaufend. Beide Arten erscheinen oft am gleichen Substrat.
Foto aus dem Höchberger Wald bei Würzburg im Januar 2022.

Pilze im Winter = Winterpilze?
Es gibt einige Pilzarten, die bei milden Temperaturen auch im Winter zu finden sind. Anders als die „echten“ Winterpilze vertragen sie jedoch keinen Frost. Ihre Zellen platzen bei Minustemperaturen, und beim Auftauen zerfallen die Fruchtkörper zu einem Matschhaufen. Der Frostschneckling (Hygrophorus hypothejus) stellt eine Übergangsart zwischen Herbst- und Winterpilzen dar. Er benötigt sehr kalte Temperaturen um Fruchtkörper zu bilden. Er ist oft noch im Dezember zu finden, verschwindet aber bei längeren Frostperioden. Daher sollten Frostschnecklinge besser im Spätherbst vor dem Wintereinbruch gesammelt werden.
Kiefernwald, Nähe Geiselwind im Steigerwald, Ende November 2023.
Das Problem mit den Herbstpilzen im Winter
Diese Fichtensteinpilze waren längere Zeit eingefroren und sollten auf keinen Fall mehr für Speisezwecke verwendet werden. Durch das frostbedingte Aufplatzen der Zellen beginnt unmittelbar die Zersetzung. Wer ein solche Fruchtkörper verzehrt, muss mit einer, teils heftigen, „unechten“ Pilzvergiftung (Lebensmittelvergiftung) rechnen.
Steigerwald, Landkreis Kitzingen, Mitte Dezember 2023.