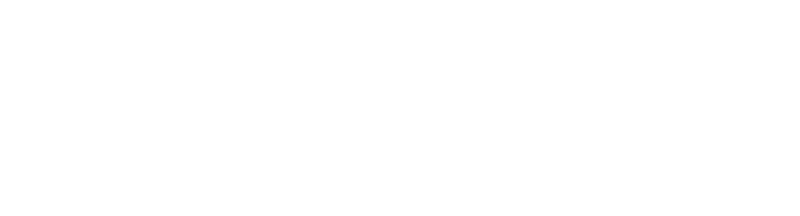Warum sich Pilzesammeln lohnt und mehr als nur ein Hobby ist
Für viele „Schwammerljäger“ steht das Sammeln von Pilzen zu Speisezwecken an oberster Stelle. Neben der kulinarischen Bereicherung gibt es jedoch viele weitere Gründe, warum sich der Einstieg in diese Freizeitaktivität lohnt.
Inhaltsverzeichnis
1. Geringe bis keine Kosten
2. Naturnähe und Bewegung
3. Regionale Artenvielfalt
4. Umweltbewusstsein fördern
Geringe bis keine Kosten
Pilzesammeln ist ein Hobby mit geringem Budgetbedarf. Die Einstiegshürden für „Gelegenheitspilzsammler“ sind äußerst niedrig. Neben angemessener Outdoor- oder Sportbekleidung benötigt man lediglich ein Pilzmesser und einen geeigneten Transportbehälter. Ein geflochtener Korb ist hierbei die erste Wahl, da er eine optimale Luftzirkulation ermöglicht und die Frische der gesammelten Pilze bewahrt.
Ein Pilzbuch ist zwar generell empfehlenswert, um sich mit den verschiedenen Arten vertraut zu machen und potenzielle Verwechslungen zu vermeiden, jedoch ist es nicht zwingend erforderlich. Viele nützliche Informationen sind kostenlos und online zugänglich, was den Einstieg zusätzlich erleichtert. Leider werden Pilzarten in öffentlichen Medien oft falsch bestimmt oder unzureichend dargestellt, daher sind nicht alle Quellen seriös. Im Zweifelsfall sollte immer eine Pilzberatungsstelle aufgesucht und die Funde vorgezeigt werden.

Pilze wie der Schopftintling (Coprinus comatus) sollten besonders vorsichtig transportiert werden, da sie leider überdurchschnittlich schnell verderben. In der Küche sollten nur rein weiße Fruchtkörper verwendet werden.
Nährstoffreiche Wiese, Landkreis Bamberg, Oktober 2021.

Naturnähe und Bewegung
Das Pilzesammeln bietet eine großartige Möglichkeit, Zeit im Freien zu verbringen und sich körperlich zu betätigen. Regelmäßige Bewegung ist für den Bewegungsapparat von entscheidender Bedeutung. Die meisten Menschen bewegen sich heutzutage zu wenig. Selbst wenn das Pilzesammeln nicht zu bedeutenden Funden führt, leistet man durch Bewegung einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit. Schon kurze und einfache Spaziergänge können sich positiv auf verschiedene Aspekte der Gesundheit auswirken, da eine Vielzahl von weit verbreiteten „Volkskrankheiten“ durch mangelnde Bewegung begünstigt werden.
Regionale Artenvielfalt
Das Sammeln und Zubereiten eigener Pilze eröffnet großartige kulinarische Möglichkeiten. Etwa 200 Pilzarten in Deutschland gelten als essbar. Neben den bekannten Klassikern wie Steinpilz und Pfifferling gibt es eine Fülle an ebenso vorzüglichen, jedoch weniger bekannten Speisepilzen. Diese Artenvielfalt lässt sich in einer Vielzahl von Gerichten kreativ nutzen und sorgt für geschmackliche Abwechslung.
Im Gegensatz dazu ist die Auswahl an käuflichen Pilzen meist sehr begrenzt, da der Handel in der Regel nur einige wenige gezüchtete Pilzarten wie Champignons (Agaricus bisporus sl.), Austernpilze (Pleurotus spec.) oder Kräuterseitlinge (Pleurotus eryngii) anbietet. Angebotene Pfifferlinge (vor allem Cantharellus cibarius und C. pallens) stammen in der Regel aus Osteuropa und müssen erst herantransportiert werden. Ein weiterer Nachteil bei gekauften Pilzen ist die oft problematische Lagerung. In eingeschweißten Packungen und unter unzureichender Kühlung verlieren die Pilze schnell an Qualität – sie werden weich und verderben. Es besteht auch das Risiko von unechten Pilzvergiftungen (Lebensmittelvergiftungen) durch verdorbene Ware.
Selbst gesammelte Speisepilze hingegen überzeugen bei ausreichender Kenntnis nicht nur durch ihre Artenvielfalt, sondern auch durch ihre Frische und Qualität. Zudem kann man diese nicht kaufen – man muss sie einfach selbst finden.

Im Supermarkt so nicht zu finden:
Fichtensteinpilz (Boletus edulis)
Flockenstieliger Hexenröhrling (Neoboletus erythropus)
Trompetenpfifferling (Craterellus tubaeformis)
Violetter Rötelritterling (Lepista nuda)
Stockschwämmchen (Kuehneromyces mutabilis)
Rauchblättriger Schwefelkopf (Hypholoma capnoides)

Herbsttrompeten (Craterellus cornucopioides) und Pfifferlinge (Cantharellus cibarius s.l.) können im gleichen Habitat gefunden werden. Die linken Fruchtkörper sind für Speisezwecke zu alt.
Alter oberflächlich versauerter Rotbuchenwald bei Ebrach, Landkreis Bamberg, Oktober 2021.
Ökologische Zusammenhänge verstehen und Umweltbewusstsein fördern
Durch Waldbegehungen kann man ein besseres Verständnis für Ökosysteme entwickeln und lernen, wie diese zusammenhängen. Das Bewusstsein für die Umwelt wird gestärkt, da viele Pilzarten oft als Indikatoren für die Gesundheit von Wäldern und anderen Lebensräumen dienen.
So gilt beispielsweise der Pfifferlingsbestand seit Jahrzehnten als rückläufig. Gründe hierfür sind vor allem landwirtschaftliche Dünnung, forstwirtschaftliche Eingriffe, Bodenverdichtung sowie unzureichender Niederschlag. Alle Pfifferlingsarten stehen in Deutschland unter Naturschutz und sind gemäß der Bundesartenschutzverordnung als „geschützt“ ausgewiesen. Dennoch ist es erlaubt, sie in geringen Mengen zum Eigenbedarf zu sammeln (§ 39 Abs. 3 BNatSchG). Jedoch haben Langzeitstudien ergeben, dass selbst nach über 20 Jahren kein Unterschied zwischen regelmäßig abgesammelten und unberührten Testflächen festgestellt werden konnte. Das Absammeln der Fruchtkörper hat somit wohl (bewiesenermaßen) kaum einen Einfluss auf das Pilzwachstum.
Darüber hinaus ist das Vorkommen vieler Pilzarten eng an spezifische Habitate gebunden. Bestimmte Pilze sind an einzelne Baumarten gebunden. Ebenso benötigen viele Arten, spezielle Bodentypen und klimatische Bedingungen, um Fruchtkörper bilden zu können. Diese Zusammenhänge verdeutlichen, wie wichtig ein gesundes und intaktes Ökosystem ist, um die Vielfalt der Pilze, Pflanzen und Tiere zu erhalten.